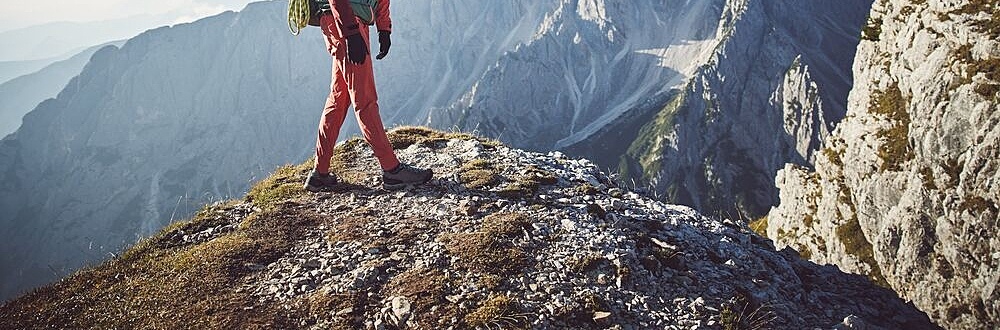Outdoor
Pflege von Outdoorprodukten
Gute Funktionsbekleidung kostet manchmal den einen oder anderen Euro mehr. Stimmt. Das liegt an der Funktionalität und der Langlebigkeit der Materialien. Diese zu erhalten, setzt die richtige Pflege voraus. Langlebigkeit spart mittelfristig nicht nur Geld, sie ist auch gut für die Umwelt.
Warum spezielle Waschmittel?
Die richtige Pflege eines Funktionsproduktes fängt mit Spezialwaschmitteln an. Sie sind so gemacht, dass Funktionen erhalten und revitalisiert werden, z. B.:
Hersteller mischen in herkömmliche Waschmittel häufig Duftstoffe hinein (ein psychologischer Trick, damit Sauberkeit gerochen werden kann), die sich an die Faser andocken oder gar in die Faser eindringen und das Feuchtigkeitsmanagement blockieren.
„Normale“ Waschmittel überlagern die wasserabweisende Ausrüstung (DWR, Durable Water Repellency) durch hydrophile (wasseranziehende) Rückstände, so dass die Stoffe Feuchtigkeit aufnehmen, statt sie abzuweisen (hydrophob). Das reduziert die Atmungsaktivität einer wasserdichten und atmungsaktiven Membran.
Gegen Geruch und für Feuchtigkeitsmanagement
Im 3-Lagen-Zwiebelsystem wird die anfallende Feuchtigkeit vom Körper nach außen transportiert. Der Schweiß geht also durch die erste, zweite und dritte Lage hindurch. Dabei bleiben Rückstände von Schweiß (Bakterien, Ammoniaksäure, Eiweiße) sowie Körperölen in den Lagen hängen. Diese blockieren das Feuchtigkeitsmanagement und fangen an, zu riechen. Waschmittel für diese Lagen müssen geruchsreduzierend wirken und das Feuchtigkeitsmanagement erhalten. Und sie müssen bei relativ niedrigen Temperaturen – bei maximal 40 °C – funktionieren. Bei der 2. Lage kommt noch die isolierende Funktion hinzu. Schweißrückstände „verkleben“ und verstopfen die feinen Fasern, die eigentlich Luft speichern sollen.
Bessere Atmungsaktivität
Beim Waschen von Membranjacken und Softshells (auch Hosen) gibt es zwei Pflegegänge. Beim Waschen geht es wieder um die Schweißrückstände. Sie reduzieren einerseits die Atmungsaktivität, in dem sie die Poren verstopfen, andererseits zerstören die Körperfette und Salze mittelfristig die Wasserdichte der Membran, indem sie die Poren vergrößern. Übrigens: Nach einem Aufenthalt am Meer ist es ratsam, Membranjacken zu waschen, um die Meeressalze, die in der Luft sind, aus der Jacke herauszuwaschen.
Membranjacken bitte regelmäßig waschen
. Hier wird ein Spezialwaschmittel genutzt, das anders als bei der 1. und 2. Lage nicht die hydrophile Funktion unterstützt, sondern die Oberfläche hydrophobiert, also wasserabstoßend macht.
Die Nässe soll nicht im Oberstoff bleiben, sondern möglichst schnell trocknen bzw. als Wasserdampf verdampfen, denn Nässe im Oberstoff mindert die Atmungsaktivität der Membran. Das ist auch der Grund, warum Funktionsjacken mit einer wasserabweisenden Ausrüstung behandelt werden. Diese DWR (Durable Water Repellency) leidet durch Abrieb, UV-Licht und Regen. Das erkennt man daran, dass der Regen auf dem Oberstoff nicht mehr abperlt. Der Fachbegriff hier ist
‚Wetting-out‘
und Wetting-out kann die Atmungsaktivität bis zu 70 % reduzieren. Auch die beste PFC DWR geht verloren oder wäscht ab. Sie muss also regelmäßig aufgefrischt werden. Das kann in einem Waschgang mit einem Tauchbad oder durch ein Spray erfolgen. Waschgänge sind in der Fläche effektiver und gleichmäßiger, mit einem Spray lassen sich besonders betroffene Stellen wie Schultern gezielter nachimprägnieren. Wichtig dabei:
Bitte keine Imprägniermittel mit PFCs nutzen
. Mittel, die man zuhause nutzt, sind hochgradig volatil – gehen also zum Großteil direkt in die (Atem-)Luft oder ins Trinkwasser. Die toxischen Wirkungen von PFCs werden immer noch kleingeredet, weil sie nicht unmittelbar wirken. PFCs sind aber persistent (dauerhaft), bioakkumulativ (reichern sich in der Natur und Organismen an) und toxisch (giftig).
PFCs und PFAS-Chemie.
PFCs und PFAS-Chemie werden als „Forever Chemistry“ bezeichnet. Mittlerweile findet man PFAS-Chemie-Verschmutzung in den entlegensten Orten (Everest, Marianengraben, Südsee-Inseln, Arktis und Antarktis), im Blut von Eisbären und allen anderen Säugetieren, 95 % der Menschen. PFAS-Chemie ist Chemie, die menschengemacht ist und erst seit 40 Jahren überhaupt hergestellt wird. PFCs verursachen Krebs, verändern die Fertilität und beeinflussen unser Immunsystem und je länger man forscht, desto mehr entdeckt man, was diese Stoffe noch alles anrichten. Auf EU-Ebene werden immer lautere Forderungen erhoben, PFAS-Chemie als Gruppe zu behandeln und insgesamt zu reglementieren (verbieten).
Loft und Wärme
Die Pflege von Daunenprodukten ist besonders wichtig, weil die Isolationsfähigkeit, also die Bauschfähigkeit (Loft) der Daunen, erhalten bleiben muss. Daunenprodukte können mit speziellen Daunenwaschmitteln in einer herkömmlichen Waschmaschine gewaschen werden (Schlafsäcke brauchen eine großvolumige Trommel). Wenn der Schlafsack schon mal nass ist, kann man die Daune auch gegen Einsatznässe imprägnieren. Diese Hydrophobierung der Daune stabilisiert die Daune gegen Verklumpen und erhält die Wärmeleistung unterwegs. Daunenprodukte müssen gründlich ausgespült werden, damit keine Waschmittelrückstände die Daunen verkleben. Die Maschine also nicht zu voll machen. Daunenprodukte können mit niedriger Drehzahl geschleudert werden. Das Schwierige an der Daunenpflege ist der Trocknungsprozess. Am besten ist hier ein großvolumiger Wäschetrockner. Man kann in den Trockner dazu ein paar Tennisbälle geben, um die Daune in der Trommel aufzuklopfen. Wenn man Daune per Hand wäscht oder diese unterwegs nass wird, hilft häufiges Aufschütteln und das Auseinanderziehen der Daunenverklumpungen.
Wachsen hilft
Baumwolle und Baumwollmischgewebe lassen sich auch mit herkömmlichen Waschmitteln waschen. Sie haben meist keine DWR und das Feuchtigkeitsmanagement ist bei Baumwolle nicht besonders hoch. Vor allem Trekkinghosen und -jacken kann man nach dem Waschen aber imprägnieren. Ein Tauchbad mit einem „Cotton-Proof“ ist auch hier einfach und effektiv. Die Alternative ist eine Bienenwachs-Paraffin-Mischung, die aufgerieben und dann eingefönt oder eingebügelt wird. Wachsen von Baumwolle oder Mischgeweben ist sinnvoll, weil die Baumwolle durch das Wachs länger trocken bleibt und auch schneller wieder trocknet.
Schuhpflege
Für die Schuhpflege gibt es mehrere Stufen:
Säubern
: Zum Säubern wird der Schuh nass gemacht und mit einem Schwamm oder Tuch vorsichtig gereinigt. Bitte auch die Sohle von Dreck befreien und gelegentlich mal innen (Schweißsalze!) feucht reinigen und das Fußbett lüften.
Trocknen
: Das Wichtigste: keine zusätzliche Heizquelle nehmen, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Wenn Leder zu schnell trocknet, wird es brüchig und dann ist der beste Schuh hin. Der Trocknungsprozess braucht Zeit, das Leder dankt es.
Pflegen:
Ist der Schuh trocken, kann man ihn einsprühen (Synthetik) oder wachsen (Leder). Bitte nie Lederfett nehmen. Das macht Leder weich und labberig. Das Lederwachs enthält ausreichend Pflegemittel und schafft gleichzeitig Nässeschutz. Reibung oder die Wärme der Finger lässt das Wachs etwas schmelzen, so dass es in das Leder eindringt. Messingteile wie Ösen leiden nicht, wenn sie Wachs abkriegen. Und noch etwas: „Viel hilft viel“ ist der falsche Ansatz.
Verstauen:
Schuhe nicht in einen feuchten Keller stellen. Ein luftiger normaltemperierter Raum ist ideal. Bei Schuhen, die länger nicht benutzt wurden, können innerhalb kurzer Zeit die Sohlen abfallen. Die Weichmacher in der PU-Zwischensohle verflüchtigen sich, die Sohle wird hart und wenn man dann geht, bricht das PU auseinander. Hydrolyse lässt sich nicht aufhalten, aber verzögern, indem man den Wanderschuh viel benutzt.
Weiterlesen